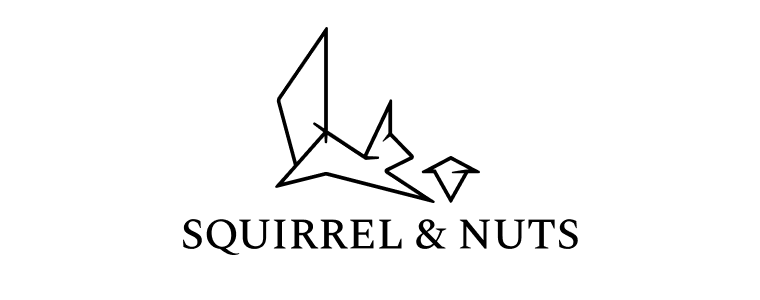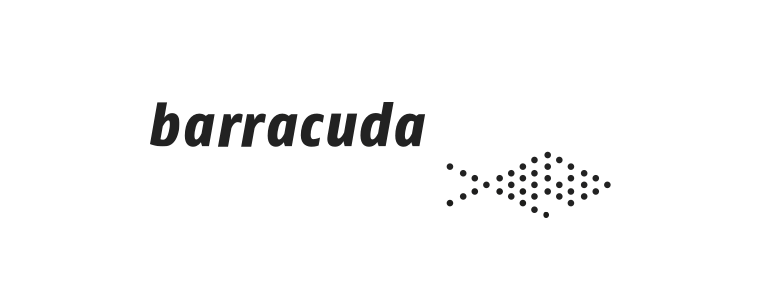Die Kirche verreckt an ihrer Sprache: Buch erschienen

„Verschrobene, gefühlsduselnde Wortbilder reiht ihr aneinander und wundert euch, warum das niemand hören will. Ständig diese in den Achtzigern hängen gebliebenen Fragen nach dem Sein und dem Sinn, nach dem wer ich bin und werden könnte, wenn ich denn zuließe, dass ich werde, was ich schon längst war. Hä?“
– „Die Kirche verreckt an ihrer Sprache“ – 2015 sorgte mein Blogeintrag mit diesem Titel für Aufregung unter Theologinnen und Theologen. Morgen erscheint passend zu den Thesen von damals mein neues Buch. Ich spreche auf 160 Seiten aus, was so viele denken – auch wenn es weh tut: Zu viele Predigten treiben die Menschen aus den Kirchen.
So hart ich die kirchliche Oberfläche angreife, so sehr bemühe ich mich auch darum, die Potentiale erfolgreicher Verkündigung zu ergründen. Ich will, dass am Ende Predigten endlich wieder besser werden.
 Mein Buch zeigt, was ich bin: Ein Mensch, der mit seiner Kirche hadert, aber nicht mit ihr bricht. Ich klage an, ich wüte und bin nicht selten verzweifelt, aber ich schöpfe auch immer wieder neue Hoffnung. Ich hoffe, am Ende steht ein erneuter Dialog zwischen meiner Kirche, den Theologen und mir, dem Kommunikationsberater. Vielleicht ist dieses Buch auch ein kleiner Beitrag zu einer neuen Kommunikationsform meiner Kirche. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Mein Buch zeigt, was ich bin: Ein Mensch, der mit seiner Kirche hadert, aber nicht mit ihr bricht. Ich klage an, ich wüte und bin nicht selten verzweifelt, aber ich schöpfe auch immer wieder neue Hoffnung. Ich hoffe, am Ende steht ein erneuter Dialog zwischen meiner Kirche, den Theologen und mir, dem Kommunikationsberater. Vielleicht ist dieses Buch auch ein kleiner Beitrag zu einer neuen Kommunikationsform meiner Kirche. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Bestellen kann man mein Buch seit heute beim Kösel-Verlag (hier…) oder bei Amazon (hier…).
Ich freue mich ganz besonders, wenn Ihr / wenn Sie diesen Artikel teilen, das Buch lesen, mir Feedback geben, es weiterempfehlen oder gar eine Rezension schreiben.
Für die Leserinnen und Leser meines Blogs ein paar Auszüge aus meinem Buch:
Seite 15: Zum Weglaufen
Mir schrieben Menschen, dass sie vor einer Weile aufgehört haben, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, weil sie die Sprache, die dort gesprochen wird, nicht mehr aushalten. Ich kann das gut verstehen. Was soll ich schon von Predigten halten, in denen Belanglosigkeiten aneinander gereiht werden.
»Jesus lädt Dich ein – ja auch Dich. Er lädt Dich ein zum gemeinsamen Mahl. Zu dem Mahl, wie er es mit seinen Jüngern geteilt hat. Das Teilen von Brot und Wein in der Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig bestärkt und aufeinander vertrauen kann. Eine Gemeinschaft, in der nicht nur Nahrung geteilt wird, sondern auch Glaube. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein.«
Sätze, in denen viel zu oft die Verben fehlen. Um dieser sinnbefreiten Aneinanderreihung von Banalitäten noch irgendeinen inneren Zusammenhang zu geben, wird in jedem Satz ein Wort des voraus gegangenen Satzes aufgegriffen, damit der Text nicht komplett in Fragmente zerfällt.
Man kann das mit gutem Gewissen schlechten Stil nennen. Er entsteht aus Überforderung. Wie soll ich denn so von Gott sprechen, dass es gleichzeitig würdig und nahbar ist? Wie soll ich denn so von Gott sprechen, dass es meine eigene Beziehung mit Gott zum Ausdruck bringt und gleichzeitig das Gegenüber zum Entdecken Gottes anregt? Wie finde ich den schmalen Grat zwischen Belehren und Erfahrbarmachen, und warum klingen diese drei Fragen schon wieder so, als hätte ein Theologe sie geschrieben?
In meinem Posteingang landet eine E-Mail. Ein mir unbekannter Mitarbeiter einer großen deutschen Diözese schreibt mir:
»Traurig, aber wahr. So ist es. Und ja: Was wir in der Kirche zu sagen haben, wird (so oft) nicht verstanden. Und dann versuchen wir es noch deutlicher auszudrücken und dann wird es noch diffuser und wirrer, und manchmal ist es wie beim Leben des Brian und seinem verwirrten Straßenprediger, der über die Verwirrung der Verwirrung …«
Ich kenne die Szene mit dem Straßenprediger gut. »Das Leben des Brian« zählt zu meinen Lieblingsfilmen. In dieser Szene stehen mehrere Prediger nebeneinander auf Podesten und versuchen, das Volk von ihrem Glauben zu überzeugen. Einer schreit, zetert und droht mit Verdammnis, und ein alter wirrer Mann predigt eben über die Verwirrung und verwirrt dabei sich und das Publikum.
Genau diese Szene kam mir auch in den Sinn, als ich gegen das Predigen in unseren Kirchen lospolterte. Sie ist so treffend und entlarvend. Seltsam, dass sie auch diesem kirchlichen Mitarbeiter sofort vor Augen war.
Die Erklärung, die er anbietet, ist interessant: Man wird nicht verstanden und versucht es dann noch deutlicher auszudrücken und wird dadurch immer unverständlicher. Die Erklärung ist so interessant, weil Glaube noch nie ganz verstanden werden wollte…
Seite 39: Flucht nach Jericho
Es ist eine schöne Kirche. Sie ist viele hundert Jahre alt. Die Kirchenbänke erzählen von Generationen betender Menschen. Jesus schaut gequält von einem alten Holzkreuz herab und nimmt den Kirchenraum ganz für sich ein. Vorne steht eine Pastoralreferentin. Sie trägt seltsame Gewänder. Zu viele Farben sind in diesem Outfit kombiniert. Sie nennt es »authentisch«, ich nenne es »oh je«.
Sie hat soeben eine kleine Schale mit warmem Wasser gefüllt und sagt laut das Wort »Wasser« in den alten Kirchenraum. Aus einem kleinen CD-Player tönt Nora Jones Musik. Beständig habe ich Angst, die CD könnte hängen bleiben. Sie ist bestimmt schon über zehn Jahre alt und nach vielen Jahren Firmunterricht verkratzt. Ich frage mich, wie viele der heutigen Firmlinge selbst schon mal Musik von einer CD abgespielt haben. Wahrscheinlich nur noch wenige. Heute hat man Lieder schlicht auf dem iPod oder Smartphone.
Bedeutungsschwanger zieht die Frau ein Knäuel vertrocknetes Zeug hervor, zeigt es den Anwesenden und sagt das Wort »Tod«. Eine andere Person am Ende des Raumes hat die Anweisung erhalten, in diesem Moment eine Klangschale anzuschlagen. Der lang gezogene Ton wummert durch den Raum.
Schließlich legt sie die vertrocknete Pflanze in das Wasser und sagt ganz ruhig und überbetont leise: »Aus Wasser und Tod kann Leben werden. Wir werden es miteinander erleben und erfahren. Ich möchte euch jetzt einladen, mit mir Abendessen zu gehen und später mit mir gemeinsam zurückzukehren, um das Wunder des Lebens zu sehen.«
Aua, das tut weh. Die Gruppe steht auf und trottet zum Abendessen in den Speisesaal des Bildungshauses. Ich bleibe sitzen und verdrehe die Augen angesichts des aufgeführten Theaterstücks.
Bei dem vertrockneten Knäuel handelt es sich um eine Rose von Jericho. Eine Wüstenpflanze, die man in jedem Esoterikladen kaufen kann. Diese Pflanzen können lange ganz ohne Wasser auskommen. Legt man sie in eine Schale Wasser, so kann man innerhalb von rund zwei Stunden sehen, wie die Wüstenpflanze grün erblüht. Gewiefte Expertinnen und Experten für gestaltete Mitten wissen aber, dass man das Verfahren mit warmem Wasser auch beschleunigen kann, sodass der Effekt schon nach rund 40 Minuten eintritt – genügend Zeit für ein Abendessen.
Mir ist der Appetit vergangen. Ich frage mich, was das hier wohl soll. Ich ahne fast, dass am Ende dieses Schauspiels noch eine Jesus-Schleife kommen wird. Irgendetwas in der Art von »auch Jesus ist durch den Tod gegangen, um dann zu neuem Leben in der Auferstehung zu kommen«. Wahrscheinlich waren seine Jünger dazwischen auch was essen, um die Zeit zu überbrücken…
Seite 93: Der alte Mann
Ich muss zur Bahn. Es ist schon wieder viel zu spät. In wenigen Minuten muss ich den ICE am Kölner Hauptbahnhof erreichen. Verpasse ich ihn, komme ich zu spät zu einem Termin in Süddeutschland. Es regnet – wie so oft in Köln. Wie viel zu oft in Köln. Ich habe ein Loch in die Sohle eines Paares alter Turnschuhe gelaufen. Wasser dringt in meinen Schuh, die Socken werden nass. Ich bin genervt.
Taxis fahren an mir vorbei. Sie fahren so schnell, dass das Wasser von der Straße bis weit auf den Bürgersteig spritzt. Links und rechts reihen sich belanglose Bürogebäude aneinander. Banken und Versicherungen, die IHK, und links im Gebüsch versteckt sich der Bischofssitz. Gegenüber einer Maredo-Filiale kommt mir ein alter Mann entgegen. Ich bemerke ihn nicht, bis er mir schließlich im Weg steht und mich auffordernd anlächelt. Ich schaue ihn verwundert an. Offenbar setzt er an, mit mir zu sprechen und sagt auf Englisch: »Excuse me, please.« – »Oh, ein Tourist«, denke ich, »der sucht bestimmt irgendetwas. Der wird ja wohl nicht den Dom suchen, den findet man allein. Weiß ich überhaupt die Antwort, aber ich kann den jetzt auch nicht stehen lassen.« – Er fragt: »Do you speak English?« Er hat eine tiefe durchdringend-nette Stimme wie ein Hörbuchsprecher. Es macht Spaß ihm zuzuhören. Noch dazu spreche ich gerne Englisch und darum antworte ich ihm, »sure«.
Daraufhin lächelt er mich noch mehr an. Ich lächle zurück. Er hat sehr große Ohren, wie alte Männer sie manchmal haben. Der alte Mann setzt an und sagt in freundlich verschmitztem Ton mit seiner tiefen, wunderschönen Stimme: »Do you know, that Jesus loves you?« – Sein Satz – »weißt Du, dass Jesus Dich liebt« – trifft mich völlig unvermittelt. Kurz bin ich verdutzt, dann völlig entnervt. Ein missionarischer Opa aus den USA. Na toll, und dafür bleibe ich in meiner Eile im Regen stehen, um zu helfen. Ich antworte nach einer sehr kurzen Pause in genervtem Ton: »Oh yes, of course!«, drehe mich um, lasse ihn stehen.
Schnell gehe ich weiter, doch sein Satz geht einfach mit. Während ich den alten Mann längst hinter mir gelassen habe, hallen seine Worte immer weiter nach. Was wollte er von mir? Was wäre eigentlich sein nächster Satz gewesen? Hätte er mir eine Bibel in die Hand gedrückt? Warum macht er das in einer fremden Stadt in einer fremden Sprache? Warum bei Regen, warum in der Nähe des Hauptbahnhofs? Was treibt diesen Mann an, mir solch einen Satz zu sagen.
Viel mehr als die Worte des alten Mannes wundere ich mich über meine eigene Antwort: »Oh yes, of course!« – »Oh ja, selbstverständlich!«. Warum habe ich ihm das geantwortet? – So selbstverständlich finde ich diese Antwort gar nicht. Dazu ist mein Glaube viel zu unstet, viel zu fragmentiert in Momentaufnahmen, viel zu zerrüttet vom Zweifeln. »Oh ja, selbstverständlich« statt wortlosem Weggehen.
Besonders macht den Satz des alten Mannes die Art wie er ihn spricht. Er fügt ihn ein in ein alltägliches Gespräch. Er weckt eine Erwartung, die in eine ganz andere Richtung weist. Er gibt mir den Eindruck, er frage meine Hilfe an und überrascht mich dann mit einem Satz, der keinem anderen Zweck dienen kann, als mir zu helfen. Er spricht ihn nicht in seltsamem Ton, nicht in der Art, wie verrückte Straßenprediger sonst sprechen, nicht mit seltsamen Wortbetonungen, wie er in Kirchen gesagt würde. Er sagt ihn ganz nebenbei, ganz freundlich, ganz nahbar. Ein seltsamer Satz und eine seltsame Begegnung. Ein kurzer Moment, in dem mir klar wird, dass das Sprechen von Gott auch mich erreichen kann. Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Weiter zum Buch: Kösel-Verlag oder Amazon.