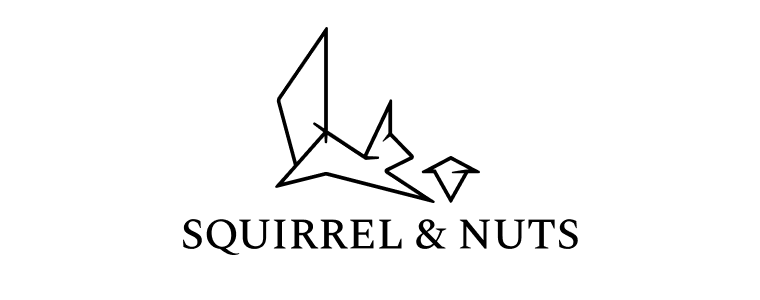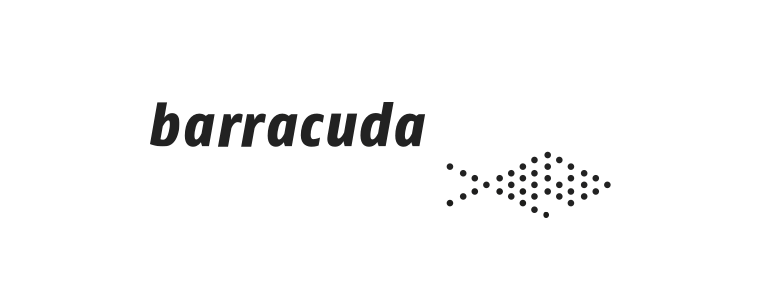Literaturexperiment: Schiller lesen zwischen Tel Aviv und Jerusalem
Es dauert nur sechzig kurze Minuten bis der Bus von Tel Aviv Jerusalem erreicht. Die beiden Städte, obgleich so nah beieinander gelegen, markieren äußerste Pole unserer Welt. Ein Kontrast zwischen den Hochhäusern der pulsierend-postmodernen Stadt am Meer und jener Stadt in den Bergen, die für so viele Jahrhunderte den Mittelpunkt der Welt markierte und dies vielleicht noch immer ist. Eine prinzipiell-dogmatische Stadt, in der sich milliardenfaches Hoffen auf Erlösung in einem Punkt verdichtet. Jerusalem, das Unikat, Zentrum holistischer Religionen, zerfällt in tausende Fragmente. In Ost- und Westjerusalem, in das arabische, das jüdische, das armenische und das christliche Viertel , in Tempelberg, dem Ort Mohammeds Himmelfahrt und Schauplatz Jesu Kreuzigung und Auferstehung. In Schlachtfeld und Friedensfeld. Diesem Scherbenhaufen aus Fragmenten steht Tel Aviv als fast schon homogene Einheit entgegen. Eine Stadt mit westlich-liberalem Lebensgefühl, bewohnt von fragmentarisch denkenden Menschen. Und gerade in der Bewegung zwischen diesen beiden Städten wird ein Dualismus, aus holistisch-fragmentiertem Jerusalem und dem fragmentarisch-holistischen Tel Aviv erfahrbar. Dieser Dualismus nimmt sich sein Recht Gedankenwelten zu prägen und so verwundert es kaum, dass Lesen zwischen Tel Aviv und Jerusalem ein ganz eigenes Textverstehen mit sich bringt.
Am Strand von Tel Aviv – zwischen sportlichen Badegästen und Fruchtcocktails – wird Schillers Jungfrau von Orleans fast zur Unerträglichkeit. Jenes Selbstbegreifen der Johanna als willenloses Werkzeug eines allmächtigen Gottes, jene Aufopferung für ein höheres Ziel, jene Negation der eigenen Gefühle, verzerrt Johanna zu einer idealisierten leblosen Marmorfigur. Eine Bilderbuchheilige (wenngleich zu Schillers Zeiten noch nicht heiliggesprochen), die voll Gottvertrauen ihre Mission erfüllen will, den versteckten Dauphin erkennt, sich für den richtigen Weg entscheidet auf gefahrvoller Reise und schließlich einen Sieg über England erringt. Und es drängt sich Schillers Schrift über das Pathetische geradezu auf. Wie er trefflich analysiert, dass die großen Bildhauer ihre Figuren nackt aus dem Stein schlugen, um sie ganz und gar Mensch sein zu lassen. Und es fragt sich der Leser, warum denn nun Schillers Johanna so ganz und gar – um im Bilde zu bleiben – in mehrere Lagen Kleider gehüllt ist; Entmenschlicht ist. In diese Badestrand-Verneinung der Jungfrau bricht geradezu erlösend Johannas Liebe ein. Das kurze Aufflackern der Menschlichkeit in ihrem Sein, das Zweifeln, das hin und her geschleudert sein. Verzweiflung als Befreiung von der Maske, vom puppenhaften übermenschlichen Ideal. Der Schmerz, die Angst, die Verzweiflung lässt sie uns Freundin werden, eine uns gleichende Auserwählte, nur um dann – während man innerlich ihr zurufen möchte, dass das Mensch sein seinen eigenen Wert besitzt – wieder zu jenem Werkzeug Gottes zu werden und schließlich in Marias Arm hinauf zu steigen; in den menschenleeren Himmel. Die Jungfrau wird Chiffre einer Fremdheit der Jenseitsperspektive in unserer Zeit. Die Ausrichtung auf das Sein nach dem Tod, es lebt nicht zwischen Hochhaustürmen, zwischen Diskotheken und Straßenkonzerten.
Das gleiche Werk, es liest, versteht sich so neu und anders, wenn man am Abend des Sabbat, zum Freitagsgebet, am Kreuzigungstage im Wirrwarr der Jerusalemer Gassen wandelt. Zwischen ultra-orthodoxen Juden in ihren schwarzweißen Roben und ihren einer anderen Zeit entsprungenen Hüten, die auf direktem Wege hinunter zur Klagemauer eilen, während Muezzins aller muslimischen Konfessionen in dissonanter Harmonie zum Abendgebet rufen und die christlichen Kirchen gemeinsam das Angelus Geläut erklingen lassen. Plötzlich ist die ganze umgebende Realität nicht mehr dem Diesseits verpflichtet. Mit jedem Kniefall eines Mulsimen gen Mekka, mit jeder Verneigung eines Juden vor der Klagemauer und mit jedem andächtigen Schritt auf der Via Dolorosa eines Christen, wendet ein Mensch den Blick vom Diesseits auf das jeden Verstand übersteigende Leben über den Tod hinaus. In solchem Moment wird die Jungfrau Teil der Menge, zum Normalzustand. Ihre Hingabe zu Gott, ihr Gehorsam erscheint nicht länger blind, sondern sehend, ahnend, wissend. Ihr Handeln, ihr Vertrauen wird Teil eines grundlegenden Urvertrauens des Menschen auf Erlösung und Erweckung und ich – mit meiner weltlichen, diesseitigen, den Augenblick begeistert ehrenden Sicht – werde zusammen mit der liebenden Johanna zur einsamen Figur. Unser menschliches Lieben, unser weltliches Leiden, wird so existenziell in Frage gestellt. Johanna wird Chiffre einer Fremdheit der Diesseitsperspektive unserer Zeit. Die Ausrichtung auf das Sein vor dem Tod, sie lebt nicht zwischen Tempelberg, zwischen Klagemauer und Grabeskirche.
Das Lesen von Literatur zwischen Tel Aviv und Jerusalem lässt erkennen, dass Literatur nicht Nebensächlichkeit, sondern existenzielles Erleben ist. Verdichtete menschliche Erfahrung – und sei sie fiktional – macht begreifbar, was im aktuellen Erleben nur situativ vage spürbar wird. Unsere innere Gefühlswelt richtet sich beständig auf die aktuelle Umgebungswelt, verbindet sich mit dieser und schützt uns dadurch vor den erschütternden Kontrasten und dem darin liegenden Zweifel oder gar Verzweifeln. So rührt das eigene Erleben das Innerste nur wenig an, denn die konkrete selbstgewonnene Erfahrung bleibt im Moment verhaftet. Verbindet sich diese jedoch mit der Radikalität, mit der existenziellen Verdichtung in Literatur, die ein ganzes Leben, ganzes Sein dadurch begreifbar macht, dass sie es in einem Punkt zusammenführt, so wird aus der Momentaufnahme eine Anfrage an unser gesamtes Sein. Dabei kann die Literatur dem Affektiven entbehren – ja sie muss geradezu auf den Affekt verzichten. Denn der Affekt in Literatur wird stets dem momenthaften des eigenen Erlebens unterlegen sein. Jedoch wird die Gesamtschau – das Grenzen sprengende retrospektive und prospektive Weiterdenken des Momentes – zu einer Grundlage für eine wahrhaftige Bewusstmachung einer Momenterfahrung. So wird in Gänze begreifbar, was zuvor noch außerhalb des Erfassbaren lag.