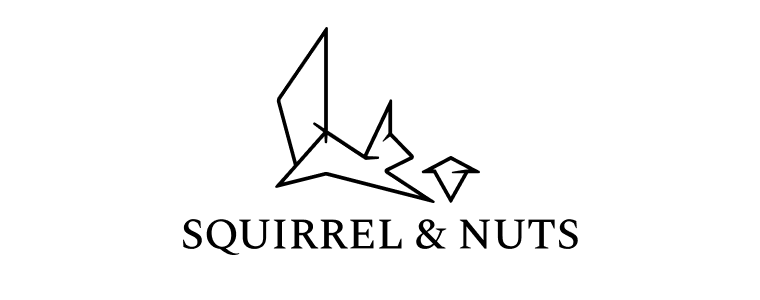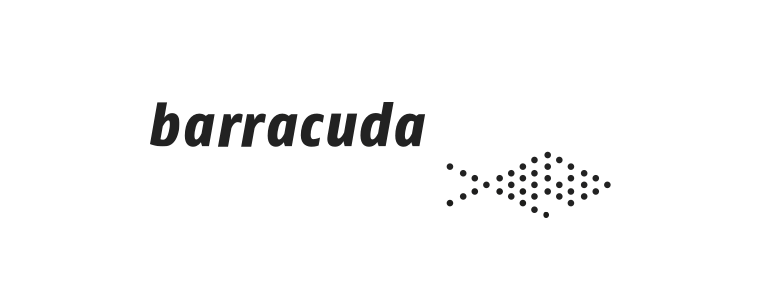Der Hexenkessel

von Erik Flügge
Die Diskussion um das Kölner CSD Motto 2020 „Einigkeit! Recht! Freiheit!“ hat die Szene gespalten. Vielleicht ist das das Einzige, worauf sich alle nach dem gestrigen Gesprächsabend zum CSD-Motto einigen können. Denn schon bei einer leicht anderen Formulierung „das Motto hat die Szene gespalten“ würden die Emotionen gleich wieder hochkochen.
Eines ist gewiss: Den Gesprächsabend zum Motto verließ niemand zufrieden. Alle hatten an diesem Abend ihre eigene Ohnmacht erlebt.
Genau das ist das Problem. Denn Ohnmacht ist eine der schwierigsten Erfahrungen, die man machen kann. Manche Menschen begleitet sie ihr Leben lang, andere erleben sie punktuell. Mit ihr umzugehen bleibt immer schwer und so bricht sich das Ohnmachtsgefühl häufig in unterschiedlichen Reaktionen Bahn. Manche Menschen beginnen zu weinen, andere zu brüllen und die nächsten verfallen in Apathie. All das haben wir gestern erlebt. Im Publikum und auf dem Podium.
Seit über zehn Jahren plane und moderiere ich beruflich als Geschäftsführer eines Büros für Bürgerbeteiligungsverfahren zum Teil hoch emotionale Veranstaltungen. In all dieser Zeit habe ich noch keinen Abend erlebt, der so sehr emotional eskaliert ist wie der gestrige, an dem ich als Gast teilgenommen habe. Ich gehe fest davon aus, dass es noch viele Berichte und Gespräche in der Szene darüber geben wird, was gestern Abend alles passiert ist. Ich möchte daher diesen Artikel lieber nutzten, um darüber nachzudenken, wie es passiert ist, um Verständnis für alle Seiten und auf allen Seiten dieses Konfliktes zu wecken.
Hinweis: Ich bin in der Frage des CSD-Mottos nicht neutral. Ich habe mich bereits in den ersten Tagen gegen das Motto positioniert. Aus wie ich finde guten Gründen. Nichtsdestotrotz sehe ich mich in der Lage zu analysieren, wie dieser Streit so sehr eskalieren konnte.
Der ohnmächtige Vorstand
Es ist ganz leicht, den eigenen Gegnern im Konflikt die Schuld für eine Eskalation zuzusprechen. Viel schwieriger ist es, den Versuch zu unternehmen, zu verstehen, was das Gegenüber fühlt. Gestern hätte ich mit dem KLUST-Vorstand nicht gerne getauscht. Sie saßen in einem überfüllten Saal vorne auf der Bühne und blickten fast ausschließlich in unfreundliche Gesichter. Sehr viele waren gekommen, um dem Vorstand zu sagen, dass sie die Entscheidung für das neue Motto nicht gutheißen.
In so einer Situation fühlt sich jeder Mensch unwohl. Wer lässt sich schon gerne konfrontieren mit Argumenten, Emotionen und Zorn? Noch dazu mit manchem Argument, das man für sich selbst so gar nicht annehmen will oder kann. Wenn man sich – wie der KLUST-Vorstand – seit Jahren gegen Rechts und für die Belange von LSBTTIQ*-Menschen engagiert und einem dann mal laut, mal leise, mal brüllend gesagt wird „das Motto löst aber das Gegenteil aus. Es stärkt rechts und es verletzt einige Teile unserer Community“, dann würde die Annahme des Argumentes auch bedeuten, dass man zustimmt, das Gegenteil dessen bewirkt zu haben, was man bewirken will. Man gerät in die Ohnmacht.
Da ist sie, die Ohnmacht eines Vorstandes, der doch eigentlich alle Macht über das Motto in Händen hält. Eine Ohnmacht, die aus dem Verfahren entsteht. Der KLUST-Vorstand hatte zur Motto-Findung eingeladen. Es wurde eines gefunden. Der Vorstand hatte es beschlossen und mit einer Begründung versehen und steht seither zwar klar auf der Seite seines Mottos und dennoch zwischen den Fronten. Denn die einen fordern die sofortige Änderung des Mottos, die anderen die Verlässlichkeit des vereinbarten Verfahrens. Um der ganzen Kritik irgendwie Herr zu werden, um wieder in die Vorderhand des Verfahrens zu kommen, lud der Vorstand zum Gespräch ein. Ein Versuch, irgendwie zwischen den Fronten einen Weg zu finden.
Das Ohnmachtsdrama des Vorstandes nahm dann am gestrigen Abend seinen Lauf. Zwischen all dem lauten Schreien tauchte ein echtes, starkes Argument nach dem anderen auf. Eine zugewanderte Person sprach davon, dass sie das Versprechen „Einigkeit und Recht und Freiheit“ zwar höre, aber für sie sei es schlicht nicht in solcher Weise erfüllt, dass sie es als Motto tragen könne. Eine ehemals obdachlose Person schilderte, dass sie nicht unter den Worten der Hymne demonstrieren könne, weil sie mit diesem Staat jetzt in unserer Zeit so viel Leid erfahren hat. Transpersonen sagten wieder und wieder und wieder, dass sie nicht mit den Worten der Hymne den Staat loben wollen und können, der sie noch immer mit diesem Transsexuellengesetz diskriminiert. Es wurde von Gruppen berichtet, die sich entschieden haben, unter diesem Motto der Demo fern zu bleiben. Es wurde drauf verwiesen, dass das Motto sich von der AfD vereinnahmen lässt, was just am gleichen Morgen durch ebendiese schon geschehen war. Es wurde ausgesprochen, was dieses Motto so schräg macht: Es spricht von Einigkeit und spaltet in der Diskussion darüber uns selbst als Szene.
Auf der Pro-Motto-Seite hingegen waren die Argumente emotionsarm. Das Verfahren sei für alle offen gewesen und deshalb müsse man das Ergebnis akzeptieren. Man selbst störe sich nicht an dem Motto. Der Rechtsstaat sei auch für uns als Community von so hoher Bedeutung, dass er aller Verteidigung wert ist.
Selten habe ich eine so erdrückende Übermacht an Argumentationskraft in einem Streit erlebt wie gestern Abend. Den Vorstand, der angetreten war, das in ihren Augen in einem legitimen Prozess entstandene Motto zu verteidigen, brachten all diese Argumente immer mehr in die Defensive. Man kann nicht einem weinenden Menschen absprechen, dass diese Person gerade eine Verletzung fühlt. Hier versagt jedes Argument, das den Rechtsstaat oder das Verfahren lobt. Der Vorstand saß versteinert vorne, hörte zu und schwieg. So handeln nach meiner Erfahrung Menschen, die wirklich ins Grübeln kommen.
Nur gleichzeitig wurden diese starken Argumente ständig unterbrochen von laut schreienden Personen, von Vorwürfen und Ungerechtigkeiten. Der Vorstand ertrug all diese Angriffe mit stoischer Ruhe und dem festen Willen, zuzuhören. Der Diskurs aber wurde ein ums andere Mal zerfetzt von immer heftiger werdenden emotionalen Ausbrüchen. Diese Mischung aus erdrückend emotionalen Argumenten und erdrückend heftig vorgetragenen Unterstellungen drängte den Vorstand so sehr in die Ecke, dass ein Weg zwischen den Fronten nicht mehr zu finden war. Entweder man gab jetzt nach und damit auch den laut Schreienden oder man verletzt diejenigen, die gerade unter Tränen ihr Gefühl gezeigt hatten. Ohnmacht.
Das ohnmächtige Publikum
Ich gehöre selbst zu den Menschen, die in ihrem Leben und Alltag fast immer die Erfahrung von Macht und Einfluss machen und fast nie die Erfahrung von Ohnmacht. Das Glück meines Lebens ist es, dass ich ständig etwas gestalten kann. Gestern Abend ging es mir wie allen Gästen auch. Ich war ohnmächtig.
Vorne saß der KLUST-Vorstand und schwieg. Das erste Argument war gefallen. Der Vorstand schwieg. Das zweite gute Argument war gefallen. Der Vorstand schwieg. Eine Aktionsgruppe sprang auf Stühle, bemächtigte sich des Wortes und verlas Namen von LGBTTIQ-Opfern unseres Staates aus jüngerer Zeit. Ein Vorstandsmitglied tanzte auf der Bühne während der Performance aus Protest. Der Vorstand schwieg. Eine Person weinte. Der Vorstand schwieg. Eine weitere Person weinte. Der Vorstand schwieg. Menschen brüllten. Der Vorstand schwieg. Eine Teilnehmerin fragte flehend, „hört ihr, was hier gesagt wird?“. Der Vorstand schwieg.
Ich könnte auch sagen, der Vorstand hörte zu. So hätte ich es auch zu Anfang noch bezeichnet, aber nach einer Stunde war aus dem Hören längst ein dröhnend lautes Schweigen geworden.
Allen im Raum war klar, dass die Macht, das Motto zu ändern nur vorne auf der Bühne sitzt. Der Vorstand muss überzeugt werden und niemand sonst im Raum. Der Vorstand schwieg. Er zeigte keine Regung. Kaum ein Nicken. Kein sichtbares Zeichen der Betroffenheit bei mancher sehr persönlicher, unter Tränen vorgetragenen, Geschichte.
Es wurde lauter. Der Vorstand schwieg. „Habt ihr uns gehört?“ Der Vorstand schwieg. Es wurde noch lauter. „Habt ihr uns gehört?“. Der Vorstand schwieg. Es wurde gebrüllt, mit zum Teil erstickter Stimme. Der Vorstand schwieg. Die Ohnmacht wurde übermächtig. Der Abend kippte in Beschimpfungen.
Als dann schließlich der Vorstand sprach – nach all dem langen Schweigen – da war der Satz, der mit Sicherheit auch eine Reaktion auf die zuletzt ausgesprochenen Beleidigungen und Beschimpfungen war, der all die Ohnmacht ins Unendliche steigerte dieser: „Wir haben euch jetzt so lange zugehört, aber ihr uns gar nicht.“
Menschen schrien durcheinander. Ohnmacht.
Der Hexenkessel
Was passiert in einem Saal, in dem alle anwesenden in Ohnmacht geraten? Der Vorstand genauso, wie die dazwischen rufenden Aktivist*innen, die Moderation genauso wie alle, die sich auf der Redeliste meldeten? – Ganz einfach, es passiert gar nichts mehr. Es herrscht ein Vakuum. Eine Leere.
Genau mit diesem Gefühl strömten gestern alle auseinander: Leere. Eine Leere, die sich gestern in allen umliegenden Kneipen in stundenlangen kleinen Gesprächsrunden voller Fassungslosigkeit entlud. Eine Szene, die unter dem Ruf „Einigkeit!“ in dutzende Grüppchen zerfällt, die nur noch zusammengehalten werden von ihrem Erschrecken über den jeweils anderen.
Ein erschreckter Vorstand über so viel aus Ohnmacht geborenen Hass, der ihm entgegen schlug.
Erschreckte Aktivist*innen über so viel Ohnmacht gegenüber einem Vorstand, der so ignorant schweigt.
Erschreckte Gäste über so viel Ohnmacht angesichts einer Diskussion, die es nicht mehr schafft, eine ebensolche zu sein.
Ein Kneipenwirt auf der Schaafenstraße brauchte es nachts um zwei Uhr dann auf den Punkt: „So ein Scheiß-Abend. Da kommen auf einen Schlag lauter schlecht gelaunte Menschen in den Laden, die alle schräg drauf sind.“
Wie es nun weitergehen kann
Die Ohnmacht muss aufgelöst werden. Sie muss aufgelöst werden auf allen Seiten und das wird nur gelingen, wenn man sich nicht mehr in einer Arena begegnet. Weder online, noch offline. Es braucht einen neu eröffneten Prozess der gemeinsamen Lösungsfindung und das wird nur gelingen, wenn man sich zu einem Arbeitstreffen statt zu einer Konfrontation trifft. Ein Arbeitstreffen unter Beteiligung des Vorstandes, unter Beteiligung einiger Aktivist*innen, unter Beteiligung einiger Gäste, unter Beteiligung von zentralen Szene-Institutionen. Ein Arbeitstreffen, das das Mandat erhält, am Ende einen Beschluss zu fassen, wie auch immer er aussehen mag.
Die zu leistende Arbeit ist, einen gemeinsamen Weg zu finden, wie unser CSD 2020 so werden kann, dass alle mitgehen können. Dass die Perspektive von Erfolgen in unserer Gesellschaft und die Frustration über das nicht Erreichte in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden. Wir müssen uns die Arbeit machen, die Perspektive von Opfern mit den Perspektiven von Gewinnern unserer Emanzipationsbewegung zusammenzubringen.
Vielleicht liegt genau darin die große Chance. Nämlich dass dieser CSD es schafft, das zu erreichen, was dem KLUST-Vorstand genauso wichtig ist wie allen, die sich gerade mit ihm streiten. Nämlich, dass unser CSD ein politischer ist. Dass wir demonstrieren und nicht nur feiern. Dass wir fordern, was uns zusteht: Ein freies Leben.
Lieber KLUST-Vorstand, ladet bitte zu diesem Prozess ein!